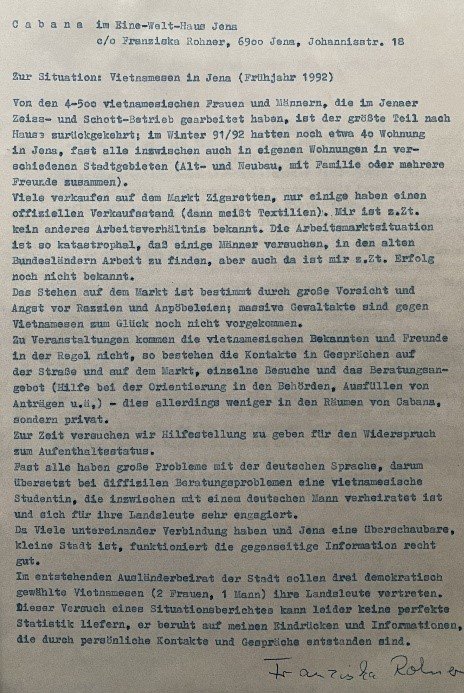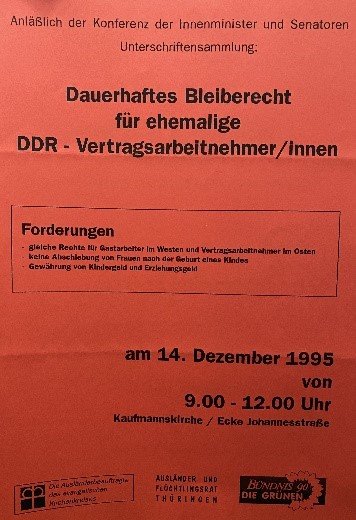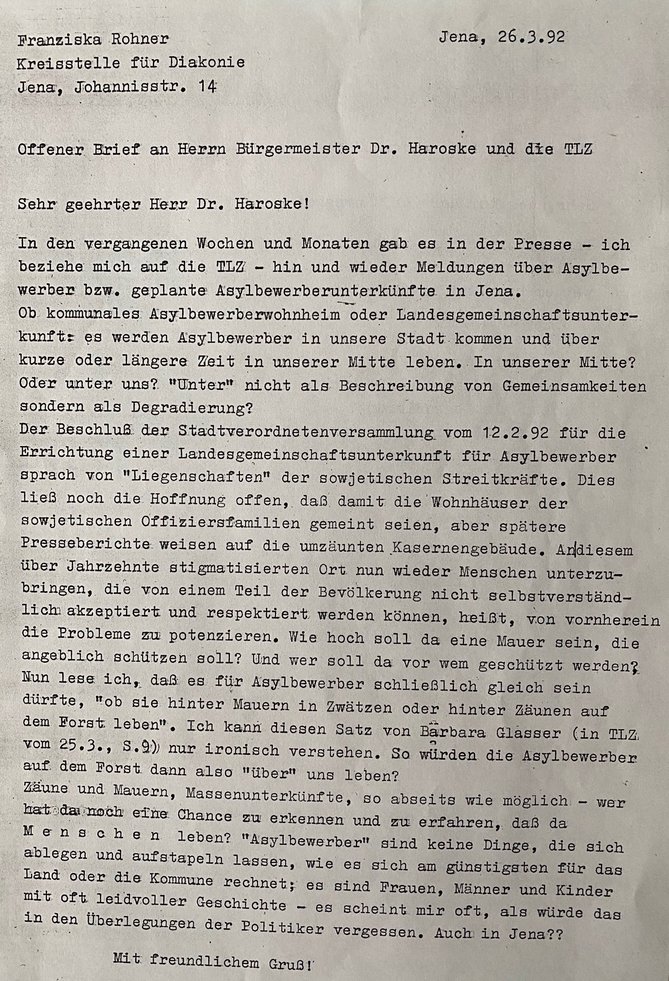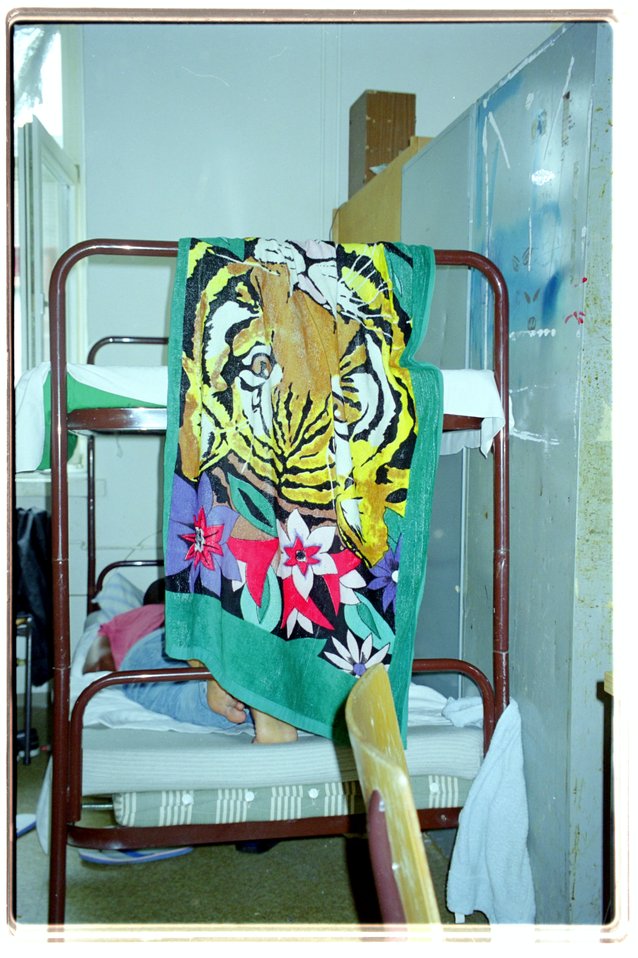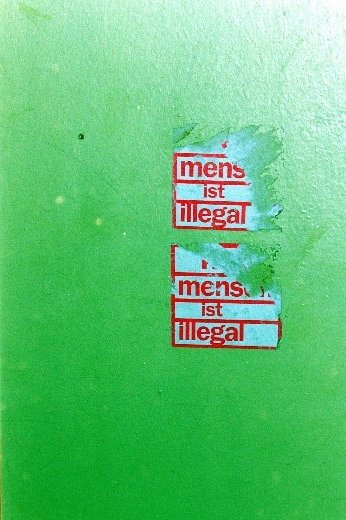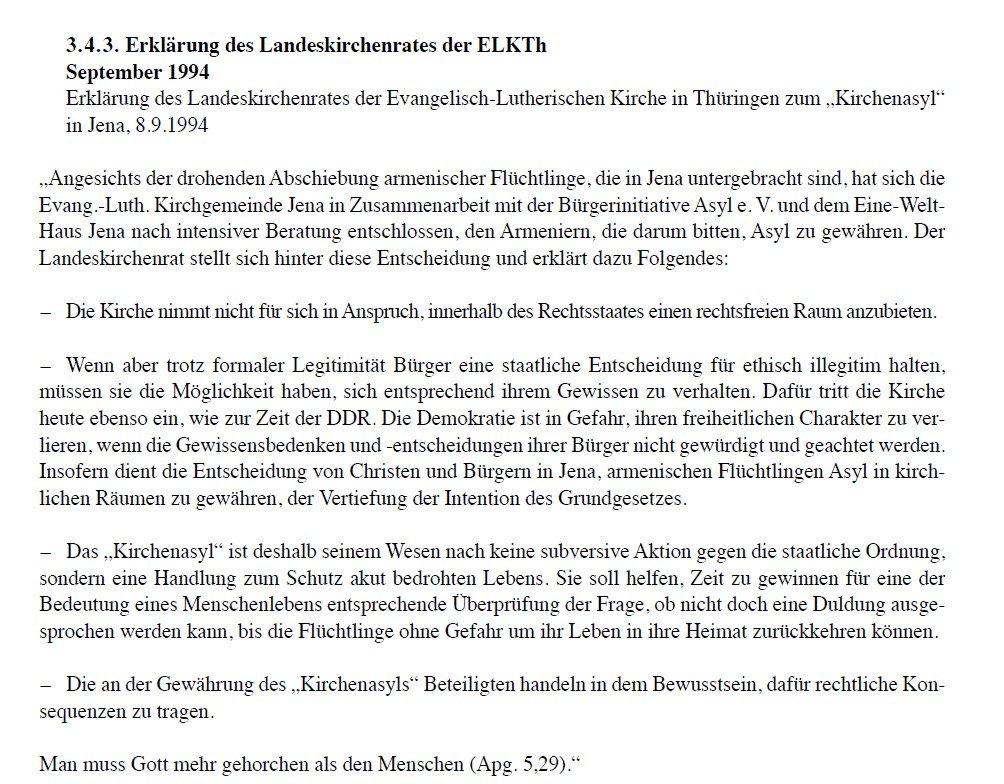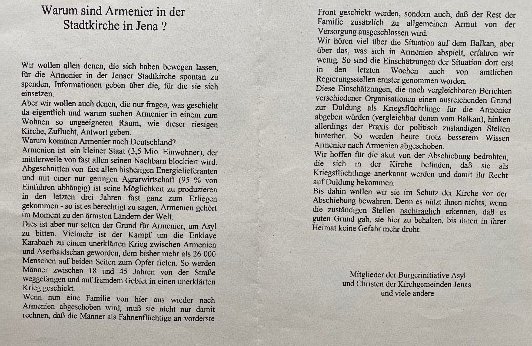Die Regierung hatte beiden nicht nur eine sichere Zuflucht, sondern auch eine Doktorarbeit in Aussicht gestellt. Sana Al-Mudhaffar ist Wirtschaftswissenschaftlerin, ihr Mann Pharmazeut. Als sie schwanger wurde, erwies sich das Versprechen als hinfällig. Die Berliner Behörden – an der Berliner Hochschule für Ökonomie hatte sie promovieren wollen – sagten ihr, zwar könne sie bleiben, das Kind aber, sobald es geboren sei, müsse das Land verlassen.
Von einem auf den anderen Moment zerschlugen sich die Pläne für eine Zukunft in der DDR – und das, obwohl Al-Mudhaffar überzeugte Kommunistin war. Noch rückblickend ist sie empört:
Kein Kita-Platz, keine Wohnung, kein Zimmer, kein Aufenthalt. Kein Aufenthalt! Das Kind muss die DDR verlassen! Habe ich gesagt: Nein! Das ist Ihre Solidarität?
O-Ton Sana Al-Mudhaffar
Also beschloss die Familie, das Land wieder zu verlassen. Plötzlich aber reklamierte Jenapharm Al-Mudhaffars Mann für sich: Seine Expertise als Pharmazeut wurde gebraucht. Und plötzlich durfte auch das Kind bleiben.
1983 zog die Familie hierher, Sana Al-Mudhaffars Mann forschte bei Jenapharm, auch sie selbst bekam Arbeit im Unternehmen. Promovieren sollte sie nie mehr. Nach der Wende aber fand sie wegen ihrer Sprachkenntnisse den Weg in die Asylberatung, arbeitete über Jahre hinweg für die Bürgerinitiative Asyl e. V. und ist heute eine der kenntnisreichsten asyl- und migrationspolitischen Expert*innen in Jena.