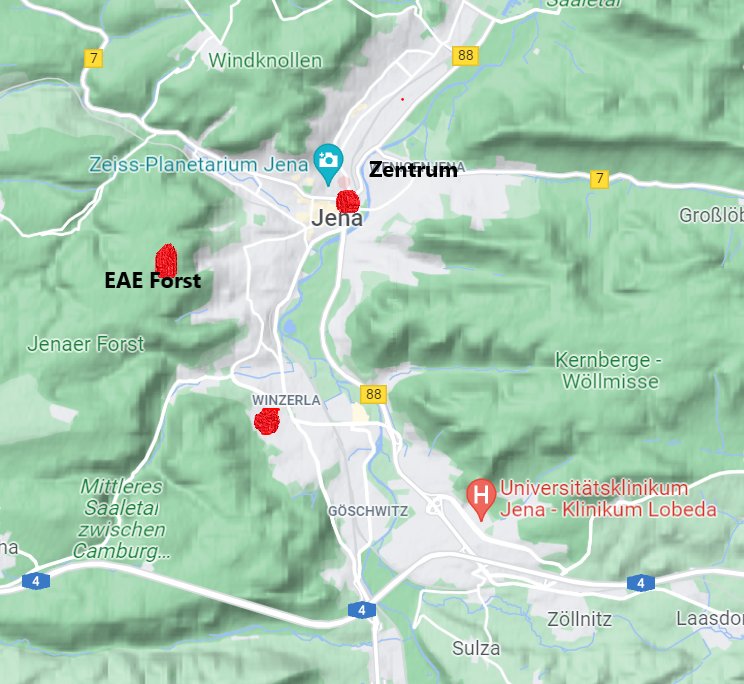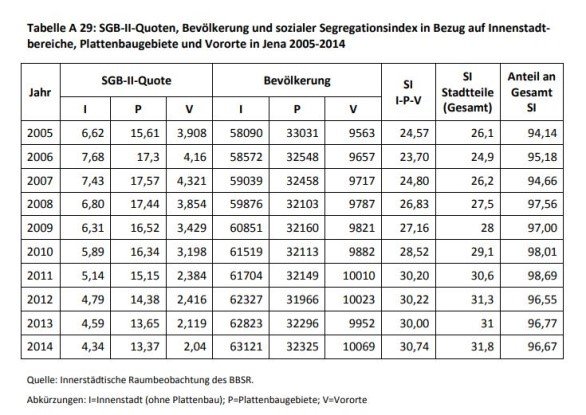Im Februar 2000 sind innerhalb weniger Tage drei rechtsradikale Angriffe dokumentiert.
16. Februar: Ein 14-jähriger Neonazi sticht am Busbahnhof einem anderen Jugendlichen mit einem Messer in den Bauch.
19. Februar: Ein politisch bei The Voice organisierter Flüchtling aus Kamerun wird beim Aussteigen aus der Straßenbahn in der Leipziger Straße in Jena Nord von Neonazis verfolgt und bedroht. Er kann sich in seine Wohnung retten, aber die Verfolger trommeln noch lange gegen die Tür.
23. Februar: Zwanzig Neonazis verfolgen und jagen vier Jugendliche, die am Westbahnhof auf einen Zug nach Gera gewartet hatten.
Zwei Monate später nutzen Neonazis, die in Lobeda einen Mann aus Zaire vor seiner Wohnungstür mit einem Baseballschläger schwer verletzt hatten, die Straßenbahn, um unerkannt zu fliehen. Im August beleidigt ein Straßenbahnfahrer einen geflüchteten Passagier rassistisch, weil er vergessen hatte, seine Fahrkarte zu stempeln. Er greift ihn außerdem körperlich an.*